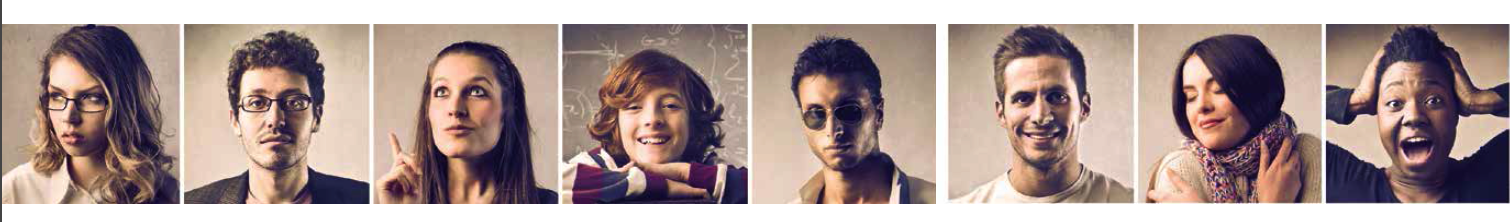Über Mythen, die unser Leben bestimmen
.
Seit Jahrzehnten geht ein Gerücht um in der westlichen Kultur, das kurz gefasst lautet: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, um es mit dem Bestseller zu sagen, der die Unterschiede der Geschlechter zum Thema hat. Ganz oben dabei ist bei solchen Betrachtungen oft die Meinung, dass Frauen eher zum Fühlen neigen und die Männer zum Denken. Aber worauf beruht eigentlich diese Annahme? Wir sind den Gründen nachgegangen.
Elizabeth Debold
„Bei allen Arten, bei denen es männlich und weiblich gibt, mit Ausnahme des Bären und des Leoparden“, schreibt Aristoteles, „haben die Weibchen weniger Mut als die Männchen. Die weiblichen Exemplare sind weicher und boshafter.“ Und weiter behauptet er: „Die Frau ist mitfühlender als der Mann, eher zu Tränen geneigt, gleichzeitig aber neidischer, eher zum Zank aufgelegt, schamloser, schneller mutlos und betrügerischer. Der Mann ist mutiger und hilfsbereiter.“
Da haben wir’s, schon vor 2300 Jahren: Frauen sind emotional, die Männer dagegen sind, wie Aristoteles an anderer Stelle bemerkt, rational.
Aristoteles muss zwar oft als Prügelknabe für Feministinnen herhalten, die ihm ankreiden, die Vormachtstellung des Mannes in der westlichen Philosophie kanonisiert zu haben, doch ich mache ihm keinen Vorwurf. In einer Krieger-Gesellschaft, in der Macht vor Recht ging, waren die Männer stärker, und das hieß automatisch: besser. Aristoteles glaubte an die Überlegenheit seiner Kultur – wozu wir alle neigen – und sah in ihr einen Ausdruck der natürlichen Ordnung. Für Aristoteles ist die Frau aus sehr offensichtlichen und praktischen Gründen ein minderwertiges Derivat des Mannes: Sie ist einfach nicht kriegstauglich. Wenn ich ihn vor dem Hintergrund der Werte seiner Zeit betrachte, kann ich mich nicht über ihn beschweren. Ich finde seine Ansicht, dass Frauen und Männer die starke und die schwache Ausgabe ein und desselben Phänomens sind, sogar ausbaufähiger als die verbreitete Vorstellung, Frauen und Männer seien Spezies von unterschiedlichen Planeten (Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus).
.
Zwischen den Polen
.
Damit sind wir beim Kern der Sache: Wie kommt es, dass die Vorstellung von der „emotionalen Frau“ und dem „rationalen Mann“ bis heute das Fundament weiblicher beziehungsweise männlicher Identität bildet? Im 21. Jahrhundert gilt uns die Gleichheit der Geschlechter zwar als hoher Wert, gleichzeitig glauben wir aber an fundamentale Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die an die Zeiten von Aristoteles erinnern. Was im Kontext der antiken Geschichte durchaus faszinierend sein mag, bedeutet in unserer zeitgenössischen Kultur eine Katastrophe. Ich möchte nicht darauf hinaus, dass Männer und Frauen vollkommen gleich sind oder gleich sein sollten. Gleichberechtigung bedeutet nicht Gleichheit oder Gleichförmigkeit. Aber die pauschale Kategorisierung von männlich/weiblich, Mann/Frau innerhalb der Polarität von rational/emotional – wobei emotional implizit gleichbedeutend ist mit „irrational“ – ist ein Problem. Wir wollen eine Kultur gestalten, in der Männer und Frauen gleichermaßen für Fürsorge und für Kreativität verantwortlich sind. Den Kern der eigenen Männlichkeit oder Weiblichkeit von Rationalität beziehungsweise Emotionalität her zu bestimmen, ist dabei unangebracht und kontraproduktiv. Es ist schwer, diesen Glauben zu überwinden, sowohl in uns selbst als auch in unserer Kultur, denn Philosophie, Naturwissenschaft und Psychologie haben einige tausend Jahre lang behauptet, dass dieser fundamentale Unterschied der Wahrheit entspricht. Aber: Ist er wirklich wahr? Wenn wir den Tatsachen ins Gesicht schauen, könnte sich ironischerweise herausstellen, dass dieser Glaube selbst etwas zutiefst Irrationales an sich hat.
Die Vorstellung, dass Frauen das emotionalere Geschlecht seien, hat sich über Jahrtausende tief in die individuelle und kollektive Psyche eingegraben. Eine Gallup-Umfrage kam noch 2001 zu dem Ergebnis, dass erstaunliche 90 Prozent der Ansicht waren, dass das Wort „emotional“ eher auf Frauen zutreffe. Habermas sagt, die Kultur bestehe aus gemeinsamen, intersubjektiven Vereinbarungen, die die Grundannahmen bestimmen, die wir von uns selbst, den anderen und der Wirklichkeit haben. Diese Vereinbarungen sind nicht bewusst, doch sie sind kodiert in der Sprache, zeigen sich in unserer Beziehung zum Körper und werden durch Gewohnheiten und Normen weitergegeben. Das Wort „hysterisch“ als Begriff für extrem emotionales Verhalten kommt vom griechischen Wort für Gebärmutter. Wenn man sich einen „femininen“ Mann vorstellt, schwingt in dem Ausdruck ebenfalls Emotionalität mit. Diese Vereinbarungen formen unser Sein, und alle stimmen darin überein, dass Frauen emotional sind.
Ich möchte hier etwas genauer untersuchen, wie tief die Polarisierung zwischen Ratio und Emotionen entlang der Grenze zwischen den Geschlechtern reicht, weil diese Idee unsere Identität und unser tiefes Selbstgefühl konstruiert. In unserem egalitären Umfeld könnte es absurd erscheinen, Frauen als eher emotional denn rational zu bezeichnen, aber statt diese kulturelle Annahme zu verändern, wird die Emotionalität von Frauen oft als Zeichen ihrer besonderen Stärke gesehen. In progressiven Kreisen, besonders wenn Spiritualität eine Rolle spielt, ist es weit verbreitet, die Übel der Moderne und des wissenschaftlichen Materialismus (Umweltzerstörung, Ausbeutung der Ressourcen, Entfremdung und Ausbeutung) der sogenannten „männlichen Führung“ und einem engstirnigen, ergebnisorientierten Denken anzulasten. Gleichzeitig wird als Gegenmittel oft die Überzeugung gehandelt, dass Frauen über größere „emotionale Intelligenz“ verfügen, wodurch Emotionen „menschlicher“ und wertvoller werden als der Verstand. Aber diese Umwertung von männlich-rational und weiblich-emotional bestärkt nur dieselbe Polarität. Es zeigt sich, dass die Verbindung von „weiblich“ und „emotional“, ob negativ bewertet im Sinne von „irrational“ oder positiv im Sinne von „sensibler“, tief in unsere sozialen Diskurse eingeprägt ist – und auch von den meisten Frauen selbst verkörpert wird.
.
Das Toben der Hormone
.
Hier möchte ich zunächst einige Grundlagen klarstellen: Frauen und Männer weisen physiologische Unterschiede auf und haben unterschiedliche Hormonprofile. Der Hypothalamus, in dem Hormone produziert werden, ist bei Männern etwas größer. Nach der Pubertät weinen Frauen häufiger als Männer, etwa vier- bis fünfmal pro Monat mehr. Erwachsene Frauen – nicht aber vorpubertäre Mädchen – haben häufiger Angststörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen als erwachsene Männer. Was aber ist der Grund für die größere Emotionalität von Frauen? „Das Toben der Hormone“, lautet häufig die Antwort: der weibliche Menstruationszyklus. Das Prämenstruelle Syndrom (PMS) macht Frauen angeblich emotionaler und daher auch irrationaler. Seltsamerweise existiert jedoch das PMS bei Frauen außerhalb der westlichen Welt gar nicht, wobei der Grund dafür nicht bekannt ist. Zudem hat die Forschung keine einfache Korrelation, geschweige denn eine kausale Beziehung zwischen dem Hormonzyklus und den emotionalen Reaktionen von Frauen feststellen können. Der Grund dafür, dass Mädchen in der Pubertät öfter ängstlich oder depressiv werden, liegt eher in ihrem kognitiven Erkennen der überwältigenden Erwartungen an junge Mädchen. Eine niederländische Forscherin resümierte in den 1990er Jahren: „Der Grundgedanke, dass Frauen emotionaler seien als Männer, sagt mehr über westliche Geschlechterstereotypen aus, als über die tatsächlichen Gefühle von Frauen.“
 Dieser „Grundgedanke“ ist für Frauen eine Quelle ihrer Identität – nach Ansicht der Frauen selbst. In einer Studie zu der Frage, ob Frauen emotionaler seien als Männer, ließ eine US-Forschungsgruppe Studentinnen und Studenten eine Woche lang über ihre Emotionen im Zusammenhang mit ihren sozialen Interaktionen Buch führen. Männer und Frauen zeigten keine Unterschiede bezüglich ihrer tatsächlichen Emotionen zum Zeitpunkt der Interaktionen: Die Bandbreite und Häufigkeit der Gefühle war dieselbe. Als die Testpersonen zu einem späteren Zeitpunkt über die Situationen befragt wurden, zeigten sich jedoch Unterschiede. Die jungen Frauen betrachteten sich als emotional ausdrucksstärker und fokussierten sich stärker auf ihre Emotionen als die jungen Männer. Die jungen Frauen mögen auch tatsächlich emotional ausdrucksstärker gewesen sein. Denn unsere Gesellschaft akzeptiert und erlaubt emotionalen Ausdruck bei Frauen in einer Weise, die bei Männern missbilligt wird. Die Forscher vermuteten, dass das Selbstbild der Frauen, das auf der gesellschaftlichen Überzeugung einer größeren Emotionalität von Frauen beruht, die Art und Weise beeinflusste, wie sie sich an ihre Erfahrung erinnern. Mit anderen Worten: Wenn Mädchen in einem Kontext aufwachsen, in dem das Frausein von der Emotionalität definiert wird, dann werden sie ihre Erfahrung im Lichte dieser Annahme interpretieren.
Dieser „Grundgedanke“ ist für Frauen eine Quelle ihrer Identität – nach Ansicht der Frauen selbst. In einer Studie zu der Frage, ob Frauen emotionaler seien als Männer, ließ eine US-Forschungsgruppe Studentinnen und Studenten eine Woche lang über ihre Emotionen im Zusammenhang mit ihren sozialen Interaktionen Buch führen. Männer und Frauen zeigten keine Unterschiede bezüglich ihrer tatsächlichen Emotionen zum Zeitpunkt der Interaktionen: Die Bandbreite und Häufigkeit der Gefühle war dieselbe. Als die Testpersonen zu einem späteren Zeitpunkt über die Situationen befragt wurden, zeigten sich jedoch Unterschiede. Die jungen Frauen betrachteten sich als emotional ausdrucksstärker und fokussierten sich stärker auf ihre Emotionen als die jungen Männer. Die jungen Frauen mögen auch tatsächlich emotional ausdrucksstärker gewesen sein. Denn unsere Gesellschaft akzeptiert und erlaubt emotionalen Ausdruck bei Frauen in einer Weise, die bei Männern missbilligt wird. Die Forscher vermuteten, dass das Selbstbild der Frauen, das auf der gesellschaftlichen Überzeugung einer größeren Emotionalität von Frauen beruht, die Art und Weise beeinflusste, wie sie sich an ihre Erfahrung erinnern. Mit anderen Worten: Wenn Mädchen in einem Kontext aufwachsen, in dem das Frausein von der Emotionalität definiert wird, dann werden sie ihre Erfahrung im Lichte dieser Annahme interpretieren.
Wie steht es um die männlichen Hormone? In welchem Zusammenhang stehen sie zu unserer Überzeugung, Männer seien rational? Angesichts des Getöses, das um Testosteron gemacht wird, erscheint es doch sehr seltsam, dass Männer kulturell als das rationalere Geschlecht gelten. Aber wenn wir an „emotional“ und „Hormone“ denken, dann stellen wir uns oft keine Männer vor, obwohl Testosteron ein Hormon ist, das mit Aggression und Dominanzverhalten in Verbindung steht. Die Kraft jener geteilten Vereinbarungen, die unsere Identitäten kulturell konstruieren, führt dazu, dass wir nicht sehen, was andererseits offensichtlich wäre: Männer werden genauso von Emotionen angetrieben wie Frauen. Aber es ist auch wichtig, in Bezug zum Testosteron nicht übermäßig zu verallgemeinern: Nicht nur finden sich bei Frauen und Männern signifikante Testosteronspiegel, sie weisen auch eine enorme Variationsbreite auf und reagieren auf unterschiedlichste soziale Kontexte. Männer, die sich verantwortungsvoll um Kinder kümmern, weisen einen signifikant niedrigeren Testosteronspiegel auf als Männer, die das nicht tun. Und wir hören nicht oft von den Frauen, die ohne medikamentöse Intervention einen höheren Grundspiegel von Testosteron haben als ein durchschnittlicher Mann. Der Eifer, mit dem versucht wird, polare Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu untermauern und zu erklären, dass sie biologisch und nicht kulturell verursacht werden, führt zu nachlässigen Forschungen. Zudem werden Selbstbilder geformt, die unsere eigene Wahrnehmung verzerren.
Unsere Gewohnheit, Unterschiede zu sehen, zu erwarten und finden zu wollen, die ein Auseinanderklaffen der Geschlechter im rational-emotionalen Bereich stützen, bestimmt oft die Interpretation sehr komplizierter neurowissenschaftlicher Daten. „Es gibt … überraschend wenig überzeugende Evidenz dafür, dass es ein ‚männliches‘ Gehirn gibt, das auf das Verstehen der Welt programmiert ist, und ein ‚weibliches‘ Gehirn, das darauf programmiert ist, Menschen zu verstehen“, stellt die Neurowissenschaftlerin Cordelia Fine in ihrem Buch Die Geschlechterlüge fest. „Unser Verstand ist außerordentlich stark auf soziale Verbundenheit ausgerichtet und überraschend empfänglich für Geschlechterstereotypen.“ In Experimenten, bei denen die Forscher „die Geschlechterfrage psychologisch in den Hintergrund drängen, gleicht sich das Verhalten von Männern und Frauen bemerkenswert an“, erklärt Fine. „Hebt jedoch das Umfeld die Rolle des Geschlechts hervor – selbst wenn das kaum merklich geschieht –, … dann gleichen sich unser Denken, unser Verhalten, die Wahrnehmung der anderen und sogar die Selbstwahrnehmung zunehmend den Geschlechterstereotypen an.“ Stellen wir uns also nur einmal den Effekt auf unser formbares Gehirn vor, den das lebenslange subtile – oder auch gar nicht so subtile – Beharren darauf ausübt, dass die Polarität zwischen den Geschlechtern nicht nur real ist, sondern auch ganz richtig.
.
Vom Aquarium ins offene Meer
.
Neurowissenschaftlerinnen wie Cordelia Fine und Lise Eliot, die Autorin von Wie verschieden sind sie?, warnen davor, dass die enthusiastische Falschinformation über fest eingeprägte Unterschiede im Gehirn von Mädchen und Jungen eine Umgebung schafft, in der die Geschlechterpolarität unter den Vorzeichen rational/emotional aufrechterhalten wird. Das wirkt sich auch auf Politik und Bildung aus – wodurch wiederum ein kultureller Kontext entsteht, der diese Unterschiede noch weiter zementiert. Vor Kurzem wurde eine Studie veröffentlicht, die mit dramatischen Abbildungen von eingeprägten Unterschieden des Gehirns bei Frauen und Männern aufwartete, aber in der Auswertung nur leichte und ungenaue Ergebnisse hervorbrachte. Aber sofort wurde der definitive Beweis der Unterschiede im „männlichen“ und weiblichen“ Gehirn ausgerufen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Ein ehemaliger Redakteur bei Forbes und Financial Times schrieb auf seinem Blog, dass diese Ergebnisse die Argumente gegen Quoten erhärten, die mehr „Frauen ins Management, an Universitäten und in die Grundlagenforschung“ bringen sollen. Warum sollte man auch Plätze für Frauen reservieren, wenn man doch die besser geeigneten Männer nehmen könnte? Fine und Eliot weisen darauf hin, dass wir die große Schnittmenge zwischen Männern und Frauen bei fast jeder Forschungsevaluation nicht bemerken. Zudem sind die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts (unter Frauen oder Männern) oft weitaus größer, als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, bei denen Männer und Frauen miteinander verglichen werden. Fine argumentiert: Wenn wir am heutigen Punkt unserer kulturellen Entwicklung – 2300 Jahre nach Aristoteles – unsere gesamte Gesellschaft um diese Kategorien herum organisieren, ist das genauso beliebig, als würden wir die Unterscheidung zwischen Linkshändern und Rechtshändern zum Bezugspunkt machen. Denn auch ihre Gehirne weisen Unterschiede auf.
Die vermeintliche Polarität zwischen dem „rationalen Mann“ und der „emotionalen Frau“ ist so allgegenwärtig wie Wasser für einen Fisch. Wir schwimmen darin. Nun müssen wir einen Weg finden, um das Wasser im Aquarium zu wechseln, während wir der Fisch sind. Das ist eine große Herausforderung, aber es ist möglich – wenn wir erkennen, wie notwendig es ist, dass wir über diese Polarität hinausgehen. Die Polarität zwischen männlich/weiblich, Verstand/Emotion konstruiert unsere Kultur, unsere Identitäten und die Grenzen dessen, was wir denken und wer wir sein können. Ein ganzer Bereich der Erfahrung bleibt unserer Wahrnehmung verborgen, wodurch auch erschwert wird, dass wir einander in einer Weise sehen und unterstützen, die uns nicht auf das jeweilige Geschlecht festlegt. Wir brauchen voneinander unsere ganze Menschlichkeit, nicht nur die Hälfte.  Die Gewohnheiten des Denkens und der Beziehungen, die sich auf Polaritäten beziehen, sind zu primitiv für die Komplexität unseres Lebens. Wenn wir die Fähigkeit entwickeln, in unserem Denken diese Zweiteilung zu durchbrechen und ein Gewahrsein für die Tiefen unseres eigenen Selbstes jenseits des konditionierten Geistes entwickeln, können wir die Wirklichkeit, in der wir leben, verändern. Die Integration von Emotion und Verstand in höheren Formen des Spürens, Wahrnehmens und Verstehens deutet auf ein Potenzial, das wir bisher noch nicht erfahren haben: Wir können Menschen sein, Menschen, die auch Männer und Frauen sind. Dann finden wir uns vielleicht außerhalb der Grenzen der Polarität wieder, im offenen Meer der Möglichkeiten.
Die Gewohnheiten des Denkens und der Beziehungen, die sich auf Polaritäten beziehen, sind zu primitiv für die Komplexität unseres Lebens. Wenn wir die Fähigkeit entwickeln, in unserem Denken diese Zweiteilung zu durchbrechen und ein Gewahrsein für die Tiefen unseres eigenen Selbstes jenseits des konditionierten Geistes entwickeln, können wir die Wirklichkeit, in der wir leben, verändern. Die Integration von Emotion und Verstand in höheren Formen des Spürens, Wahrnehmens und Verstehens deutet auf ein Potenzial, das wir bisher noch nicht erfahren haben: Wir können Menschen sein, Menschen, die auch Männer und Frauen sind. Dann finden wir uns vielleicht außerhalb der Grenzen der Polarität wieder, im offenen Meer der Möglichkeiten.
HINWEIS: Die evolve 02 Print-Version ist ausverkauft, aber als PDF-Version noch erhältlich.
Die evolve 02 als PDF kann HIER bestellt werden.